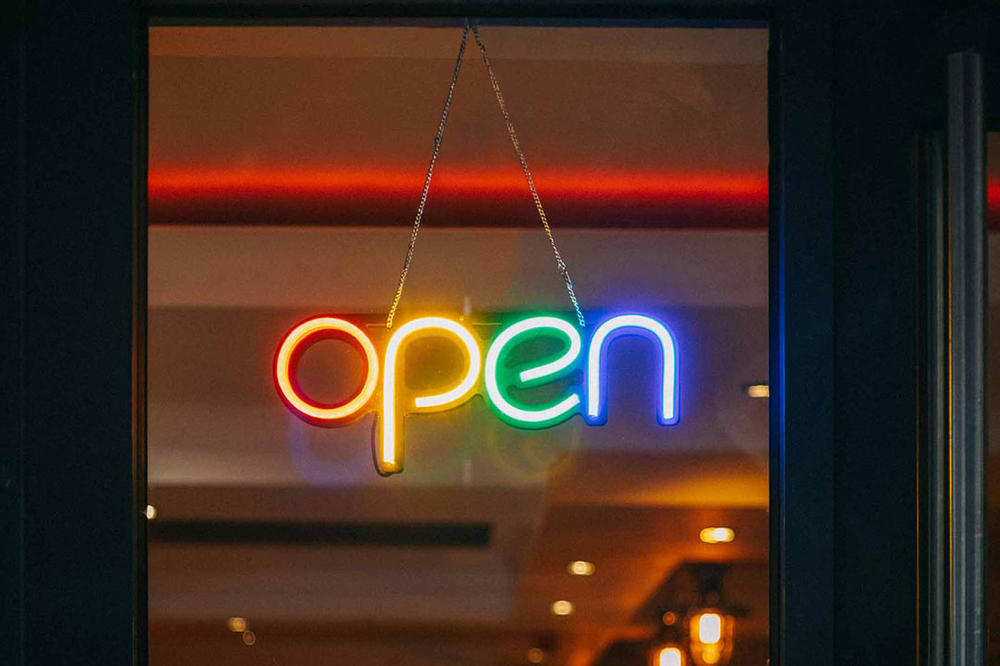„Open Science ist eine Kultur, die wachsen muss“
Interview mit Frank Fischer, Open-Science-Beauftragter der Freien Universität, und Dennis Mischke, Open-Access-Beauftragter / 21. Januar, 18 Uhr: Antrittsvorlesung Professor Frank Fischer
13.01.2025
Open Science bedeutet: offenen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Bildquelle: unsplash/Viktor Forgacs
Am 21. Januar um 18 Uhr hält Frank Fischer seine Antrittsvorlesung im neuen Amt: »Flüsse mit Ufern. Literaturgeschichten und digitale Infrastruktur«.
Frank Fischer, Professor für Digital Humanities, ist Open-Science-Beauftragter. Das Amt wurde an der Freien Universität Berlin neu geschaffen.
Bildquelle: Eric M - Encre Noire
Herr Professor Fischer, was verbirgt sich hinter dem Begriff „Open Science“?
Frank Fischer: Open Science ist eng verknüpft mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Wissenschaft und Gesellschaft. Es geht demnach um ein sehr weites, durchaus voraussetzungsreiches Phänomen.
Grundlegend handelt es sich, wie der Name sagt, um wissenschaftliche Praktiken, bei denen die „Openness“, das heißt der offene Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, im Vordergrund steht und zwar über den gesamten Forschungszyklus. Das heißt also von den ersten Ideen und Hypothesen für ein Projekt bis hin zur Kommunikation der Ergebnisse.
Grundlegend sind beispielsweise die Aspekte „Open Source“ und „Open Data“. Nach diesen Prinzipien stellen Wissenschaftler*innen ihre Forschungsdaten und gegebenenfalls auch Quellcode in offenen Repositorien zur Verfügung und laden durch die Festlegung offener Lizenzen zur Nachnutzung ein. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen. In meinem Fach, den Digital Humanities, haben wir damit gute Erfahrungen gemacht.
Es geht aber immer auch darum, die Grenzen dieser Offenheit zu verhandeln, beispielsweise wenn Urheberrechts- oder Persönlichkeitsrechte betroffen sind. Ein zentraler Grundsatz von Open Science lautet: So offen wie möglich, so geschlossen wie nötig.
Neben offenen Forschungspraktiken umfasst Open Science nach dem einschlägigen Verständnis der UNESCO offene Forschungsinfrastrukturen, offenes Engagement gesellschaftlicher Gruppen sowie offenen Dialog mit anderen Wissenssystemen, die beispielsweise von indigenen Gemeinschaften entwickelt und gepflegt werden.
Unser Verständnis von Open Science knüpft bewusst an den internationalen Diskurs zu offener Wissenschaft an, ist ein inklusives Konzept und umfasst das gesamte an der Freien Universität vertretene Fächerspektrum.
Was sind Ihre Aufgaben als Open-Science-Beauftragter?
Frank Fischer: Ich sehe meine Funktion darin, die Prinzipien und Grundwerte von Open Science universitätsweit in Forschung und Lehre zu vertreten und voranzutreiben. Die Freie Universität hat sich bereits 2006 durch die Unterzeichnung der „Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities“ zu wesentlichen Leitsätzen einer offenen Wissenschaft bekannt.
Gleichzeitig gibt es seit einiger Zeit verstärkt Bemühungen, beispielsweise auf europäischer Ebene, Open Science in der Wissenschaftslandschaft nachhaltig zu verankern. Das ist sehr begrüßenswert, reicht allerdings nicht aus. Open Science kann man nicht einfach anordnen. Es ist eine Kultur, die wachsen muss. Diesen Bottom-up-Prozess möchte ich unterstützen und möglichst viele Kolleg*innen, Lehrende und Studierende, daran beteiligen.
Mir ist es wichtig zu betonen, dass ich nicht als Einzelperson agiere. Als Beauftragter für Open Science habe ich vielleicht etwas mehr Sichtbarkeit, spreche aber für ein größeres Team. Die entscheidenden Impulse sollen aus der Open Science Working Group (OSWG) der Freien Universität kommen.
Diese Gruppe wurde ursprünglich vor fünf Jahren gegründet, wird aber momentan neu aufgestellt und soll grundsätzlich allen interessierten Universitätsangehörigen offenstehen. Die OSWG wird die hiesige Expertise zu offener Wissenschaft bündeln, Akteure vernetzen, Mentoringpotenziale heben, erfolgreiche Praktiken sichtbar und nach Möglichkeit für andere Forschungsbereiche fruchtbar machen sowie neue Handlungsfelder erschließen und gemeinsam Zielvorstellungen für die Freie Universität entwickeln.
Neben den bereits eingangs genannten Aspekten offener Forschungsdaten und -software werden wir uns inhaltlich insbesondere mit der Reform der Forschungsbewertung, offenen Methoden (z. B. Präregistrierung), offener Hardware und Infrastrukturen, mit offenen Lehr-Lernmaterialien, aber auch gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten und mit der Integration dieser Themen in die grundständigen Studiengänge und die Doktorand*innenausbildung beschäftigen.
Darüber hinaus gibt es weitere Kontexte, in denen wir das Thema in seinen vielfältigen Facetten vorantreiben können, etwa im Rahmen der OpenX-Initiative der Berlin University Alliance (BUA) und insbesondere bei der Umsetzung des gemeinsamen Leitbildes für eine Offene Wissenschaft, ganz konkret und mit Blick auf den internationalen Forschungsraum aber auch durch Projekte wie „DraCor“, die „Drama Corpora“-Plattform, die ich selbst mit aufgebaut habe und um die sich mittlerweile eine Community gebildet hat, die literaturwissenschaftliche Forschung nach Open-Science-Prinzipien betreibt.
Insgesamt gibt es viel zu tun und nur gemeinsam mit vielen Köpfen und Händen können wir diese Arbeit in den kommenden Jahren voranbringen.
Herr Mischke, Sie unterstützen die Freie Universität künftig als Open-Access-Beauftragter. Was sind Ihre Aufgaben?
Dennis Mischke: Open Access ist, wie bereits angemerkt, ein integraler und im Vergleich zu manchen anderen Aspekten bereits langjährig bewährter Bestandteil von Open Science. Es geht im Wesentlichen darum sicherzustellen, dass wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und zunehmend auch Forschungssoftware frei zugänglich und nachnutzbar sind, das heißt ohne finanzielle oder rechtliche Schranken.
An der Freien Universität wollen wir es unseren Forschenden ermöglichen, in Open Access zu veröffentlichen. Dafür stellen wir Informationen bereit, bieten Beratung, finanzielle und infrastrukturelle Unterstützung an oder treten Konsortialverträgen mit großen wissenschaftlichen Verlagen bei.
Im Rahmen von sogenanntem „Green Open Access“ haben Forschende beispielsweise die Möglichkeit, ihre Publikationen – gegebenenfalls nach einer bestimmten Embargozeit – in unserem institutionellen Repertorium, dem Refubium, oder einem Fachrepositorium ihrer eigenen Wahl zu veröffentlichen.
Viele wissenschaftliche Fachverlage bieten auch ein sogenanntes „Gold Open Access“-Modell an. Die Publikationen sind dabei für Leser*innen umgehend im Internet frei verfügbar – allerdings müssen Wissenschaftler*innen für die Veröffentlichung eine Gebühr, die article oder book processing charge, an den Verlag entrichten. In solchen Fällen können wir als Universitätsbibliothek Forschende der Freien Universität unter Beachtung gewisser, gängiger Förderkriterien mit Mitteln aus unserem Open-Access-Publikationsfonds unterstützen. Schließlich – und aus meiner Sicht von besonderer Bedeutung – fördern wir gezielt den Ausbau von Veröffentlichungen im Modus des „Diamond Open Access“ (Diamond OA).
Wodurch zeichnet sich dieses Modell aus?
Dennis Mischke: Diamond Open Access beschreibt einen Ansatz, bei dem die Inhalte sowohl für Leser*innen als auch für Autor*innen kostenfrei publiziert werden können. Dafür müssen Infrastrukturen und Services geschaffen werden, die möglichst unabhängig von kommerziellen Anbietern agieren.
Im Rahmen der BUA haben wir hier mit unseren Partnern HU, TU und Charité bereits durch die Gründung von Berlin Universities Publishing (BerlinUP) einen Meilenstein erreicht. BerlinUP funktioniert vollständig nach den Prinzipien des Diamond OA. Im Rahmen der Kooperation liegt die Verantwortung der Freien Universität dabei auf den Zeitschriften des Verlages. Das Verlagsprogramm umfasst aktuell neun Zeitschriften und soll in den nächsten Jahren weiter wachsen.
Worin liegen aus Ihrer Sicht die Vorteile von Open Science für Wissenschaft und Gesellschaft?
Dennis Mischke: Ein klarer Vorteil von Open Access ergibt sich beispielsweise hinsichtlich der Sichtbarkeit, Auffindbarkeit und Zugänglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse. Open-Access-Publikationen sind sofort weltweit für jeden Menschen – Fachleute wie interessierte Laien – kostenfrei verfügbar, können damit einfacher genutzt werden und erzielen im Regelfall höhere Zitationswerte. Und durch mehr Offenheit und höhere Publizität kann auch die sonst weitgehend unsichtbare Arbeit als Gutachter*in transparent gemacht, anerkannt werden und somit die eigene Reputation gestärkt werden.
Viele, gerade jüngere Gutachtende, arbeiten oftmals unter prekären Rahmenbedingungen im stillen Kämmerlein. Wenn man nun beispielsweise zu einem Open Peer Review übergeht, kann die intensive Arbeit und fachliche Expertise der Gutachter*innen öffentlich sichtbar und im Idealfall über einen eigenen Digital Object Identifier (DOI) auffindbar und zitierbar werden. Im Kontext der Zeitschriftensparte von BerlinUP wurden in diesem Bereich bereits erste, vielversprechende Schritte unternommen, die es in der Zukunft mit Augenmaß fortzuentwickeln und zu verstetigen gilt.
Weitet man den Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft, so trägt Open Access zu Effizienz und Beschleunigung im Forschungs- und Innovationszyklus bei, zu einer fundierten und breit aufgefächerten Informationsversorgung und zu mehr Klarheit und Gerechtigkeit im Umgang mit Steuergeldern.
Frank Fischer: Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von Forschungsdaten, Untersuchungsmethoden und Resultaten sind zunächst einmal grundlegende Pfeiler der guten wissenschaftlichen Praxis. Open Science geht es somit darum, die Forschung voranzubringen, ihre Qualität zu sichern und zu stärken.
Die Vorteile von Open Science – gerade hinsichtlich barrierefreier und schneller Zugänglichkeit, Prüfung, Aus- bzw. Wiederverwertung von Forschungsdaten und -ergebnissen – sind beispielsweise während der Corona-Pandemie deutlich geworden. Offene Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten haben die Effizienz und Geschwindigkeit im Umgang mit den vielfältigen Herausforderungen der Pandemie erhöht, sodass Open Science sowohl für die Wissenschaft als auch für die Gesellschaft einen Mehrwert darstellt.
Diese Einsicht hat sich während COVID-19 bewährt und seither nicht an Aktualität eingebüßt. Als Beauftragter für Open Science möchte ich mit allen interessierten lehrenden und lernenden Kolleg*innen aus sämtlichen Fachrichtungen der Freien Universität dafür sorgen, dass Offenheit als wesentliche Säule des wissenschaftlichen Arbeitens weiter Anerkennung gewinnt und sich zum Standard einer zeitgemäßen Forschung im 21. Jahrhundert entwickeln kann.
Die Fragen stellte Dennis Yücel