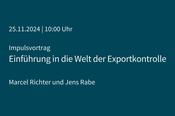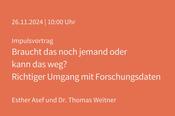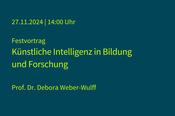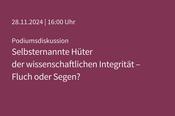„Es muss ein Umdenken stattfinden“
25. bis 29. November: Zum zweiten Mal findet an der Freien Universität Berlin die Woche der guten wissenschaftlichen Praxis statt. Ombudsperson Sabine Kropp erklärt, worum es dabei geht.
01.11.2024
Wissen darüber, was gute wissenschaftliche Praxis ist, ist von Beginn des Studiums an wichtig.
Bildquelle: Michael Fahrig
Vom 25. bis 29. November 2024 findet an der Freien Universität Berlin die Woche der guten wissenschaftlichen Praxis statt – die Freie Universität veranstaltet sie zum zweiten Mal. In zahlreichen Workshops und Vorträgen werden verschiedene Aspekte der wissenschaftlichen Integrität beleuchtet. Im Interview erklärt Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut und eine von zwei zentralen Ombudspersonen der Freien Universität, wie gute wissenschaftliche Praxis aussieht – und wie in Konflikten vermittelt werden kann.
Frau Kropp, was ist gute wissenschaftliche Praxis (GWP)?
Unter diesem Begriff versteht man traditionell gewachsene Prinzipien und Handlungsregeln für Forschende, deren Einhaltung einerseits die Zuverlässigkeit unserer Ergebnisse sicherstellen, andererseits den fairen Umgang miteinander garantieren soll – ein allgemeines Berufsethos für Wissenschaftler*innen, wenn man so will.
Machen wir es etwas konkreter: Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen Beiträge und die Beiträge Dritter ist ein zentrales Prinzip der GWP. Das bedeutet nicht nur die Einhaltung von Zitationsregeln, sondern auch, dass Mitarbeitende namentlich als Ko-Autor*innen einer Studie genannt werden, wenn sie einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.
Die Regeln der GWP sind seit der letzten Reform durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Jahr 2019 mittlerweile sehr umfangreich und betreffen den Umgang mit Forschungsdaten, die Dokumentation und Qualitätssicherung in der Forschung sowie die Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Aber auch der Umgang mit Abhängigkeitsverhältnissen, das integre Verhalten in Gremien oder die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen sind Bereiche der guten wissenschaftlichen Praxis.
Sabine Kropp ist Professorin für Politikwissenschaft an der Freien Universität und Ombudsperson.
Bildquelle: privat
Wie ist GWP an der Freien Universität verankert?
Wir hatten an der Freien Universität einen sehr fruchtbaren Diskussionsprozess mit den Ombudspersonen, dem Präsidium und dem akademischen Senat, wie wir unser eigenes Regelwerk zur GWP an die geänderten Rahmenbedingungen in der Forschung anpassen. Das war auch notwendig, denn der mittlerweile außer Kraft getretene Ehrenkodex zur GWP war über 20 Jahre alt.
Im Ergebnis haben wir im Februar eine neue Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis verabschiedet, die für alle Mitglieder der FU verbindlich ist. Drei Jahre zuvor hatten wir bereits das Ombudswesen der FU reformiert. Zusätzlich zu den Ombudspersonen der einzelnen Fachbereiche gibt es seit 2021 auch zwei zentrale Ombudspersonen – derzeit Joachim Heberle und mich.
Unsere Aufgabe ist die Beratung des Präsidiums in Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis und die Unterstützung der Fachbereichs-Ombudspersonen, die wir regelmäßig treffen. Wir beraten aber auch Hinweisgeber*innen, die sich bei einem vermuteten Verstoß gegen die GWP aus nachvollziehbaren Gründen nicht an die Ombudspersonen ihres eigenen Fachbereichs wenden möchten.
Die Koordinationsstelle für wissenschaftliche Integrität (KowIn) berät alle Angehörigen der Freien Universität zu Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis und unterstützt sowohl die zentralen Ombudspersonen als auch die Mitglieder der Untersuchungskommission in ihrer Arbeit.Mit welchen Themen wendet man sich an Sie?
Die Ombudspersonen können bei allen vermuteten Verstößen gegen die GWP angesprochen werden. Das heißt im Umkehrschluss: Bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen, persönlichen Konflikten oder Diskriminierung können wir nicht weiterhelfen und verweisen in diesem Fall auf die einschlägigen Beratungsstellen.
Eine Herausforderung ist freilich, dass die meisten Konflikte mehrdimensional sind, also bspw. der Vorwurf einer mangelhaften Betreuung mit einer Auseinandersetzung über eine Vertragsverlängerung einhergeht.
Nun aber zu Ihrer Frage, die ich dank der Jahresberichte zur Lage der GWP, die die FU seit nunmehr zwei Jahren veröffentlicht, auch empirisch fundiert beantworten kann: In den meisten Fällen geht es entweder um Konflikte bei der Nutzung von Forschungsdaten, um Betreuungskonflikte oder um den Vorwurf des Plagiats bzw. Ideendiebstahls. So haben wir schon Fälle erlebt, bei denen Professor*innen sich Ergebnisse aus Masterarbeiten zu eigen gemacht haben, ohne die Urheber*innen zu würdigen.
Erstaunlich für uns ist, dass Autorenschaftskonflikte bisher eine untergeordnete Rolle spielen, obwohl diese in deutschlandweiten oder internationalen Statistiken die größte Fallgruppe bilden.
Wie gehen Sie in solchen Fällen vor?
Zunächst einmal hören wir die hinweisgebende Person an und prüfen die Vorwürfe. Das weitere Verfahren gibt unsere schon erwähnte Satzung vor: Wenn es substanzielle Hinweise auf einen Verstoß gegen die GWP gibt, dann verfolgen wir den Fall in Absprache mit den Betroffenen weiter.
Im nächsten Verfahrensschritt muss selbstverständlich auch die Gegenseite angehört werden – und hierfür muss die betroffene Person in der Regel bereit sein, ihre Anonymität aufzugeben. Leider endet unsere Tätigkeit häufig an diesem Punkt, denn aus verständlichen Gründen wagen sich viele Betroffenen nicht aus der Deckung.
In vielen Fällen können wir allerdings auch einen gemeinsamen Schlichtungsprozess einleiten. Darin liegt überhaupt das Wesen des Ombudswesens: Es geht erst einmal nicht um Sanktionierung, sondern darum, die Konfliktparteien in einem vertraulichen Rahmen dabei zu unterstützen, einen guten Kompromiss zu erzielen und die gute wissenschaftliche Praxis wieder herzustellen.
Das ist freilich nur dann möglich, wenn das Fehlverhalten noch korrigierbar ist. Bei schwerwiegenden Fällen übergeben wir den Fall an die Untersuchungskommission der Freien Universität. Dies ist seit der Reform des Ombudswesens aber erst ein Mal notwendig gewesen.
Worum wird es bei der diesjährigen GWP-Woche gehen?
Wie schon im vergangenen Jahr beleuchten wir unterschiedliche Facetten der guten wissenschaftlichen Praxis. Der Festvortrag wird die Herausforderungen für die wissenschaftliche Integrität behandeln, die vom Einsatz Künstlicher Intelligenz ausgeht. Die damit verbundenen Fragen treiben aktuelle viele Mitglieder unserer Universität um. Darüber hinaus gibt es Workshops zum Umgang mit Konflikten in Betreuungsverhältnissen, zu Forschungsdaten, Raubjournalen oder zur Plagiatsvermeidung.
Ich selbst werde an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, bei der es um die sogenannten „Plagiatsjäger“ gehen wird. Seit einigen Jahren werden ja immer wieder Dissertationen von meist prominenten Personen öffentlich seziert. Dann schlägt die Diskussion oftmals hohe Wellen. In manchen Fällen führt eine Überprüfung berechtigterweise zur Aberkennung von Doktorgraden.
Manchmal stellt sich jedoch heraus, dass die Plagiatsvorwürfe unbegründet sind – und die Person, deren wissenschaftliche Integrität zuvor wochenlang öffentlich in Zweifel gezogen wurde, hat den Schaden. Ähnliche Entwicklungen gibt es mittlerweile bei vermuteter Bildmanipulation in den Natur- und Lebenswissenschaften. Über das Für und Wider dieser selbsternannten „Hüter der wissenschaftlichen Integrität“ möchten wir ins Gespräch kommen.
Wie wollen Sie das Thema GWP an der Freien Universität künftig weiter vorantreiben?
Einmal wollen wir erreichen, dass sich noch mehr Personen an uns wenden, die von einem wissenschaftlichen Fehlverhalten betroffen sind. Das Dunkelfeld ist leider noch sehr groß – wir sehen nur die Spitze des Eisbergs.
Als langfristiges Ziel wollen wir mehr auf Vorsorge als auf Nachsorge setzen. Die GWP sollte so im Universitätsbetrieb verankert werden, dass die Ombudspersonen nur selten tätig werden müssen.
Dazu müssen wir Studierende, Lehrende und Forschende umfassend über ihre Rechte und Pflichten aufklären, zum Beispiel über geeignete Veranstaltungsangebote. Mit einem GWP-Teacher-Training haben wir bereits eine Grundlage dafür geschaffen.
Darüber hinaus machen einige Fachbereiche GWP-Kurse für Promovierende bereits verpflichtend. Das ist eine begrüßenswerte Tendenz, an die wir anknüpfen müssen. Eine große Aufgabe für die Zukunft wird es sein, unsere Anreizsysteme so zu gestalten, dass sie die gute wissenschaftliche Praxis fördern und nicht unterminieren.
Wo sehen Sie hier Ansatzpunkte?
Ein Ansatzpunkt ist der Wandel von einer rein quantitativen zu einer qualitativen Bewertung wissenschaftlicher Leistungen. An der Freien Universität galt die Anzahl der betreuten Doktorarbeiten lange als ein Beweis für die Forschungsstärke eines Arbeitsbereichs.
International geht der Trend aber genau in die andere Richtung! Für mein Fach liegt es beispielsweise auf der Hand, dass eine Professorin nicht mehr als fünf oder sechs Promovierende gleichzeitig vernünftig betreuen kann.
Ähnliches gilt auch für die Zahl der Publikationen. Wenn Forschende einen starken Druck verspüren, beim Publizieren mehr auf Quantität als auf Qualität zu setzen, wirkt das der guten wissenschaftlichen Praxis genau entgegen. Hier muss ein Umdenken stattfinden.
Die Fragen stellte Dennis Yücel
Weitere Informationen
- Das Programm umfasst Vorträge und Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Integrität
- Veranstaltungsort ist das Seminarzentrum in der Silberlaube, Otto-von-Simson-Straße 26, 14195 Berlin
- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.