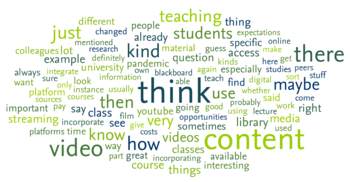„Making Streaming Media Sustainable“ – Internationales Benutzungsforschungsprojekt
23.02.2023
Gemeinsam mit 23 weiteren Hochschulbibliotheken haben wir im vergangenen Jahr Interviews mit Dozierenden über den Einsatz externer Videos in der akademischen Lehre geführt. Die an der Freien Universität erzielten Ergebnisse der Studie fassen wir Ihnen hier zusammen.
Denken Sie bei „Video-Streaming“ zuerst an die private Nutzung von Netflix, Amazon Prime und Co. – und fragen sich, was eine Universitätsbibliothek damit zu tun hat?
Der direkte Online-Abruf von externen Videos ist nicht nur für den privaten Gebrauch interessant: Wir sehen in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg des Videoeinsatzes in der akademischen Lehre, der beim Lehrpersonal zu einem steigenden Bedarf führt, geeignete Inhalte zu finden und zu streamen. Kanadische und US-amerikanische Hochschulbibliotheken prognostizierten jüngst sogar einen Anstieg des Anteils von Video-Datenbanklizenzen um 100% in den nächsten fünf Jahren.
Der Anstieg des Videoeinsatzes in der universitären Lehre bedeutet indes keineswegs, dass Lehrende sich der Verantwortung entziehen, eigene Inhalte zu gestalten. Vielmehr wird die Lehre angereichert, indem man etwa durch Videos Primärquellen zugänglich macht (bspw. ein Originalinterview) oder Lehrinhalte zusätzlich illustriert (bspw. einen Versuchsablauf). Neben Quellen wie YouTube gibt es dafür auch Video-Datenbanken mit speziell auf universitäre Bedürfnisse ausgerichtete Videos. Die Universitätsbibliothek der Freien Universität lizenziert derzeit beispielsweise Kanopy (Spielfilme und Serien), JoVE (naturwiss. Modelle und Versuchsabläufe) und weitere Video-Datenbanken.
Mit 23 weiteren Hochschulbibliotheken, darunter auch die Bibliotheken der Harvard University und der Johns Hopkins University, hat die UB der Freien Universität in den vergangenen eineinhalb Jahren Antworten auf die Frage gesucht, wie sich für Lehrende ihre Praxis, Perspektiven und Erwartungen an die Universitätsbibliothek bezüglich des Einsatzes von Videomaterial für die Lehre entwickeln. Anhand eines gemeinsamen Leitfadens wurden an allen beteiligten Hochschulen insgesamt 244 Interviews mit Lehrenden geführt. Geplant und koordiniert wurde das Projekt von der US-amerikanischen not-for-profit Forschungsagentur ITHAKA S+R, die eine Meta-Analyse der 244 Interviews aller Standorten vornahm. Die Ergebnisse sind jüngst hier veröffentlicht worden.
Erkenntnisse aus den Interviews an der Freien Universität
An der Freien Universität berichteten uns neun Dozierende verschiedener Fächer, darunter insbesondere Kultur- und Medienwissenschaften aber auch Lebenswissenschaften, von ihrer Lehrpraxis mit Videos. Anhand dieser Interviews hat das Projekt-Team der UB eine eigene Analyse vorgenommen, deren Ergebnisse sich fast vollständig mit den internationalen Gesamtergebnissen decken. Zentrale Aspekte dabei waren:
- Externe Videos wurden von den Interviewten in der Lehre als Primärquelle und Sekundärquelle genutzt, d. h. zu illustrativen Zwecken, aber auch als eigentlicher Analysegegenstand.
- Der Einsatz von Sekundär-Videomaterial ist aus Sicht aller Interviewten mit vielfältigen didaktischen Vorteilen und Chancen verknüpft, darunter die Förderung von multisensorischem Lernen, das die kognitive Involvierung der Studierenden erhöht. Auch sind Videos neben Textquellen für einige eine gute Ergänzung für digitale Lehrsituationen, wie sie während der Corona-Pandemie notwendig wurden.
- Bei der Auswahl von geeignetem Videomaterial spielen inhaltliche Qualität, (kostenlose) Zugänglichkeit und die Video-Länge eine Rolle. Sprache (Englisch/Deutsch) und Auflösung waren beim Suchprozess nachrangig. Für den Einsatz von Videos direkt in den Lehrveranstaltungen gilt allerdings: Die Clips müssen so kurz wie möglich sein, in der Regel zwischen einer und max. 15 Minuten.
- Mehrheitlich wurde über den Einsatz kostenfrei verfügbarer Videos von den Plattformen YouTube, Vimeo und aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken berichtet. Gerade die kommerziellen Quellen bringen jedoch einige Nachteile und sind auch mit Unannehmlichkeiten verbunden (z. B. Werbung und Zugangsbeschränkungen). Die Übernahme von Kosten für den Zugang zu Video-Einzeltiteln durch die Studierenden wurde mehrheitlich abgelehnt und von den Interviewten eher als Notlösung eingesetzt.
- Die Mehrheit sprach sich für die Nutzung von non-kommerziellen Open-Source-Lösungen und Open Educational Resources (OER) aus. Hier spielt auch die Nachnutzung von Videomaterial, das Kolleg*innen produziert haben, eine Rolle.
- Vom gezielten Austausch mit anderen Lehrenden über die Einbindung von externen Videos berichteten die Interviewten eher vereinzelt. Wenn er stattfand, orientierte sich der Austausch in der Regel an konkreten Fragen.
Wie geht es weiter?
Die Universitätsbibliothek wird die im Rahmen der Studie gewonnen Erkenntnisse natürlich in künftige Lizenz-Entscheidungen einbeziehen. Parallel arbeiten wir derzeit an Ideen, wie wir die Entwicklungen und Anforderungen der Lehrenden an der FU in Sachen Video-Streaming künftig noch besser und regelmäßiger in Erfahrung bringen können.
Uns ist es wichtig, auch mit Ihnen dazu im Austausch zu bleiben! Sie haben diesbezüglich Bedarfe, wünschen Beratung oder haben Hinweise an uns? Dann wenden Sie sich gerne an den Leiter der Abteilung Zugang und Bestand der Universitätsbibliothek, Mario Kowalak (mario.kowalak@fu-berlin.de), oder an Sina Menzel von der Stabsstelle Benutzungsforschung (sina.menzel@fu-berlin.de).
Projektteam der UB: Mario Kowalak (Leiter der Abteilung Zugang und Bestand), Dr. Cosima Wagner (Liaison-Bibliothekarin Ostasienwissenschaften), Dr. Julian Katz und Lea Schneider (Bibliotheksreferendar*innen), Sina Menzel (Stabsstelle Benutzungsforschung, Projektkoordination)