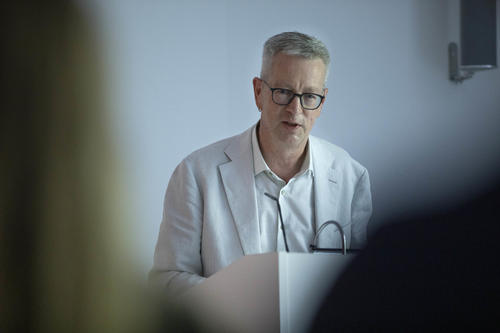Wenn Perkolationstheorie poetisch wird
Oswald Egger hielt die Siegfried Unseld Vorlesung an der Freien Universität Berlin
02.07.2025
Oswald Egger hielt die siebte Siegfried Unseld Vorlesung an der Freien Universität Berlin.
Bildquelle: Christian Demarco
Der Schriftsteller und Georg-Büchner-Preisträger 2024 Oswald Egger war zu Gast an der Freien Universität Berlin. Im Rahmen der Siegfried Unseld Vorlesung lud er das Publikum ein, Sprache als Denkraum zu erfahren und das Denken poetisch zu befragen. Die Veranstaltung am 19. Juni 2025 war Teil des Sommerprogramms des Dahlem Humanities Center (DHC) und beruht auf einer langjährigen Kooperation des DHC mit dem Suhrkamp Verlag.
Räume für reflektiertes und auch grenzüberschreitendes Denken zu schaffen, das sei entscheidend in einer Zeit, in der öffentliche Debatten oft laut und schablonenhaft geführt würden. „Das ist es, was wir heute tun“, sagt Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin. Die Siegfried Unseld Vorlesung biete genau diesen Raum, in dem Literatur, Wissenschaft und Öffentlichkeit in einen differenzierten Dialog treten.
Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität, hielt das Grußwort.
Bildquelle: Christian Demarco
Dass Oswald Egger an diesem Abend zu Gast ist, versteht Ziegler als Ausdruck dieser Offenheit. Eggers Texte führen wissenschaftliche Begriffe in neue Bedeutungsräume und eröffnen ungewohnte Perspektiven. Denken bedeute, so zitiert Ziegler Ernst Bloch, ein Überschreiten sowohl von Disziplinen, Gewissheiten als auch von Sprachgrenzen. Bei Egger lasse sich genau dieses Überschreiten besonders deutlich beobachten.
Ein Autor, ein Verlag, eine Stadt
Auch Suhrkamp-Verleger Jonathan Landgrebe betont, die Unseld Vorlesung sei ein Forum, in welchem „differenziertes Denken und präzises Schreiben Raum finden“. Oswald Egger verkörpere diesen Anspruch eindrucksvoll: Seit 1999 im Suhrkamp-Programm vertreten, verbinde er in seinem Werk Mathematik, Zeichnung und Poesie zu einer vielschichtigen Sprachkunst, die sich gängigen Kategorien entziehe. Dass die Veranstaltung in Berlin stattfindet, habe dabei auch symbolische Bedeutung: Seit dem Umzug des Verlags von Frankfurt am Main in die Hauptstadt im Jahr 2010 sei Suhrkamp nun wieder dort, wo Literatur, Stadtgeschichte und intellektuelles Leben eng verwoben seien.
Literaturwissenschaftsprofessorin Jutta Müller-Tamm führte in die Siegfried Unseld Vorlesung ein.
Bildquelle: Christian Demarco
Sprachlandschaften im Schwebezustand
Im Zentrum des Abends steht aber Oswald Egger selbst, und ein Ankündigungstext, der bereits im Vorfeld einige Nachfragen aufgeworfen habe, sagt Jutta Müller-Tamm, Professorin für Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin und Direktorin der Friedrich Schlegel Graduiertenschule. Doch diesen Umstand versteht sie nicht als Missverständnis, sondern als programmatische Herausforderung. Eggers Schreiben sei alles andere als glatt lesbar. „Die Erhellung von Einzelstellen mag hilfreich und per se auch überhaupt nicht falsch sein, ist aber doch radikal unzulänglich im Umgang mit Oswald Eggers Schreiben“, erläutert Müller-Tamm in ihrer analytischen Einführung.
Was aber sind „Zustandssummen“, der Titel des Ankündigungstextes? Ursprünglich stammt der Begriff aus der statistischen Physik und bezeichnet die Summe aller möglichen Zustände eines Systems. Doch Oswald Egger macht daraus ein poetisches Prinzip. Müller-Tamm betont, dass sich der Begriff auch klanglich lesen lässt: als Summen eines Zustands, als die Lautwerdung von Sprache.
Plauderlaune nach der Lesung: Oswald Egger im Gespräch mit dem Publikum.
Bildquelle: Christian Demarco
Diese doppelte Lesbarkeit verweise auf ein zentrales Verfahren von Eggers Schreibens: die poetische Aneignung wissenschaftlicher Fachbegriffe, insbesondere aus Mathematik, Stochastik und Physik. Oszillation, Renormierungsgruppe, Übergangswahrscheinlichkeit, was dort präzise Konzepte sind, werde bei Egger zu offenen Denkfiguren. Sprache werde zum Experimentierraum, in dem sich Welt ordnet, verschiebt, neu zusammensetzt.
Eggers Werke, so Müller-Tamm, funktionierten dabei wie Cluster. Sie sind durch Begriffe, Bilder, Rhythmen und Wiederholungen miteinander verbunden. Kein Text stehe für sich, jeder sei Teil eines größeren, permutativen Sprachprozesses, vergleichbar mit einem Möbiusband, in dem sich Innen und Außen beständig ineinander verkehren. „Jedes seiner Bücher, jeder seiner Vorträge verhält sich zu Vorangegangenem“, sagt Müller-Tamm, „was zählt, ist die Ausdehnung, das fortwährende Werden dieser Sprachwelt.“
Oswald Egger liest
In genau diese Sprachwelt darf das Publikum nun eintauchen. Oswald Egger beginnt zu lesen und lässt dabei Worte, Zahlen und Gedanken flirren. Mal leise tastend, mal mit hörbarem Enthusiasmus trägt er seinen Text vor. „Was für ein Ding soll denn der Sinn schon sein, was ich nicht für mich behalten kann, werde ich auch nicht verschwenden an die Verständigung“, heißt es etwa, und: „Mein 1×1 allein ist schon so einzig, dass es keine 2 mehr braucht zur Zweiheit.“ Und anderswo: „Dass ich Denken gleich Schauen setze, das Gefühl habe, dass die Denkoperation identisch ist mit dem Aufeinanderfallen in selbst versilbten Aufmerksamkeitszentren und nichts anderes.“
Während das Publikum den Abend schließlich bei Brezeln, Weißwein und Apfelsaft ausklingen lässt, bleiben Eggers Ausführungen noch spürbar und hallen nach, in den Gedanken, Gesprächen und Zwischenräumen.