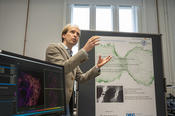Intensiver Austausch
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sprach mit dem Präsidium der Freien Universität Berlin und informierte sich im Hahn-Meitner-Bau über biochemische Forschung
02.12.2022
Bettina Stark-Watzinger (links) diskutierte mit den Mitgliedern des Präsidiums der Freien Universität (rechts: Vizepräsidentin Prof. Dr. Verena Blechinger-Talcott) im Goldenen Saal über aktuelle wissenschaftspolitische Themen.
Bildquelle: Bernd Wannenmacher
Das Präsidium der Freien Universität Berlin tagte, wichtiger Punkt auf der Agenda: ein Besuch von Bettina Stark-Watzinger, Bundestagsabgeordnete und Bundesministerin für Bildung und Forschung. Die FDP-Politikerin wurde von Tobias Bauschke begleitet, der als Mitglied der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin wirkt.
Die Ministerin begrüßte die Anwesenden herzlich, nahm dankend eine Tasse Kaffee entgegen und setzte sich zu ihnen an den langen Tisch im sogenannten „Goldenen Saal“ – einem Ort mit Geschichte, wie Universitätspräsident Professor Günter M. Ziegler in einem kurzen Rückblick auf die Universitätsvergangenheit berichtete. Den Auslöser für die Gründung der Hochschule lieferte er dabei mit: Systemkritische Studierende und Dozierende wurden an der damaligen Universität Unter den Linden im sowjetischen Sektor des geteilten Berlins verfolgt. An einer neuen Universität im Westteil der Stadt wollten sie in Freiheit lernen, lehren und forschen.
„Wissenschaft und Politik sind eben untrennbar“, folgerte Bettina Stark-Watzinger – und gab damit den passenden Einstieg in die Diskussion über aktuelle wissenschaftspolitische Themen. Mit Blick auf die berufliche Laufbahn von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plädierte sie dafür, den Menschen möglichst frühzeitig nach der Promotion Klarheit über eine dauerhafte Festanstellung an Universitäten zu bieten.
Universitätspräsident Ziegler betonte, wie wichtig Flexibilität bei der Qualifikationsphase nach der Promotion zugleich sei. Nach der Promotion müsse ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren „dynamisch“ gehalten werden, sagte er. In dieser Phase sind befristete Postdoc-Stellen eine Chance zur Weiterentwicklung. Durch sie könnten unter anderem auch ausländische Wissenschaftler*innen einfacher für Forschungsaufenthalte an Universitäten gewonnen werden. Die Ministerin kündigte einen Referentenentwurf zur Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetz für Anfang 2023 an. Ziel sei es, Mindeststandards bei wissenschaftlichen Karrierewegen zu setzen.
Ausgetauscht wurden auch Positionen zur Finanzierung von Sanierungs- und Bauvorhaben der Hochschulen und zu der vom Finanzministerium für Januar 2023 geplanten Umsatzsteuer auf Doppelprofessuren zwischen Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen. Für diese Besteuerung konnte Bettina Stark-Watzinger in letzter Minute einen zweijährigen Aufschub erwirken.
Sieben Professuren über das Professorinnenprogramm
Die Bundesforschungsministerin erkundigte sich auch über die Umsetzung des Professorinnenprogramms an der Freien Universität Berlin, ein Programm, das zum Ziel hat, die Zahl der Wissenschaftlerinnen auf Hochschulprofessuren zu erhöhen. Japanologie-Professorin und Erste Vizepräsidentin der Hochschule Verena Blechinger-Talcott verwies darauf, dass damit bislang sieben Professuren umgesetzt werden konnten. Mit den freigewordenen Mitteln habe die Freie Universität Berlin andere innovative Maßnahmen auf den Weg bringen können.
So sei etwa in den Naturwissenschaften ein Projekt für Wissenschaftlerinnen in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit gestartet worden. Die Kolleginnen bekämen nun zusätzliche personelle Unterstützung für Experimente im Labor, die sie selbst nicht ausführen dürfen. Zugleich blieben die Forscherinnen jedoch die Leiterinnen der Experimente, betonte Verena Blechinger-Talcott. Zudem würden Wissenschaftlerinnen an der Freien Universität nun verstärkt bei Transfer- und Ausgründungen unterstützt.
Nach dem intensiven Austausch über Hochschulpolitik brachen Gastgebende und Gäste auf zu einem kurzen Ausflug in den Hahn-Meitner-Bau auf dem Campus in Dahlem, wo die biochemischen Arbeitsgruppen der Freien Universität forschen.
Vizepräsidentin Petra Knaus, selbst Professorin für Biochemie, führte die Gruppe durch das Haus, ihre Kollegen stellten eine Auswahl aktueller Forschungsprojekte vor. Helge Ewers etwa ist einer neuen Strategie gegen die Krankheit Krebs auf der Spur: Übliche Medikamente hemmen die Zellteilung und sollen auf diese Weise verhindern, dass sich die Krebszellen weiter im Körper ausbreiten. Doch diese Medikamente zerstören auch Immunzellen und haben daher schwere Nebenwirkungen.
Biochemische Forschungsprojekte zu Krebs und Arteriosklerose
Deshalb nimmt er mit seinem Team nun sogenannte Septine genauer unter die Lupe. Diese Gruppe von Proteinen spielt bei der Teilung fast aller Arten von Körperzellen eine Rolle, außer bei Immunzellen. Könnte man ihre Funktion mit neuartigen Wirkstoffen gezielt stören, blieben Immunzellen unbehelligt. Helge Ewers führte vor, wie mit neuen Techniken der Mikroskopie kleinste Details im Ablauf der Zellteilung sichtbar gemacht werden können. So hoffen die Biochemiker*innen, die Funktion der Septine aufzuklären und sie zum Ziel für Krebsmedikamente ohne immunsuppressive Nebenwirkungen zu machen.
Petra Knaus berichtete über ihre Forschung zu Arteriosklerose, einer häufigen Gefäßerkrankung, bei der sich Arterien durch krankhafte Ablagerungen verengen und verhärten. Dies kann zum Herzinfarkt, Schlaganfall und zu anderen Durchblutungsstörungen führen. Zusammen mit weiteren Forschungseinrichtungen untersucht die Biochemikerin an einem Modell des menschlichen Blutflusssystems, wie sich das Genom von Endothelzellen, also der Zellen, die Blutgefäße auskleiden, bei einem pathologischen Blutfluss verändert. „Letztlich wollen wir klären, warum an bestimmten Stellen der Gefäße Arteriosklerose entsteht“, sagt sie.
Bettina Stark-Watzinger zeigte sich beeindruckt, auch davon, sagt sie, was es noch alles zu erforschen gibt. Doch der Terminplan einer Ministerin ist eng getaktet, sie musste weiter. Sie freue sich schon auf einen nächsten Besuch in der Zukunft – mit neuen Aha-Erlebnissen.