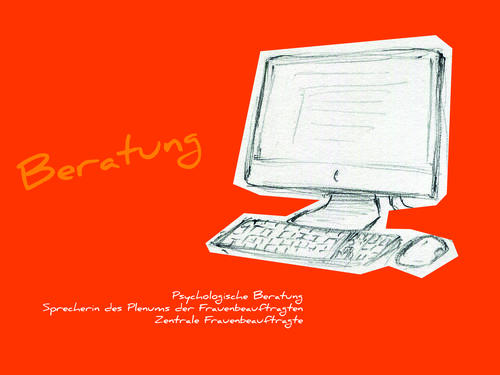Vertrauliche Beratung in Krisenzeiten
Einblicke in die E-Mail-Beratung der Arbeitsgruppe Gegen Sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt der Freien Universität Berlin
Die Covid-19-Pandemie hat in sämtlichen Bereichen des Lebens und der Arbeit Veränderungen herbeigeführt. Eingefahrene Prozesse funktionierten nicht mehr, Bedarfe haben sich gewandelt und Prioritäten sich verschoben. Gerade der Beginn des Lockdowns war geprägt von Verunsicherungen, teils Ängsten und immer wieder neuen technischen und strukturellen Herausforderungen. Auch die Angebote von vertraulicher Beratung an der Freien Universität Berlin waren und sind davon betroffen: Die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Gegen Sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt (AG SBDG), die zentralen und dezentralen Frauenbeauftragten sowie andere Anlaufstellen für vertrauliche Beratung, wie etwa die Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische Beratung oder die Beratungsstellen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), mussten mit der veränderten Situation umgehen und sich eine Reihe an Fragen zur Umgestaltung ihres Beratungsangebots beantworten.
Erhebungen aus vorhergehenden Krisenzeiten legen es nahe, Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen warnten: Häusliche Gewalt nimmt in Zeiten von Einschränkungen des täglichen Lebens, wie während der Corona- Pandemie, zu. Gleichzeitig ist es für Gewaltbetroffene aufgrund der steten Präsenz der Täter*innen schwieriger, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Vor diesem Hintergrund gilt und galt es umso mehr, Betroffene auf weiterhin existierende Beratungsangebote im Fall von Belästigung, Diskriminierung und Gewalt aufmerksam zu machen und den Zugang dazu so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Auf ihren Webseiten machen die AG SBDG und die zentrale Frauenbeauftragte daher deutlich, dass Beratung weiterhin angeboten wird. Vor-Ort-Beratung fiel während des Lockdowns weg; durchführbare Formate blieben nunmehr Telefon- und E-Mail-Beratung, die zuvor selten waren, sowie Chatberatung, die bis dato gar nicht stattgefunden hatte.
Anders als bei einigen Anlaufstellen an der Freien Universität, bei denen während des Lockdowns häufiger am Telefon oder auch mal bei einem Spaziergang beraten wurde, fand die Beratung der AG SBDG fast ausschließlich per E-Mail statt. Darauf galt es, sich einzustellen. Doch wie ist das Fazit der letzten Monate zum E-Mail-Beratungsformat? Grundsätzlich ist es positiv, per E-Mail weiterhin Beratung anbieten zu können. Die Anfragen bei der AG SBDG nahmen seit dem Lockdown zu – möglicherweise ein Resultat der Einführung der neuen E-Mail-Kontaktadresse –, so dass der Ein- druck entstand, dass es für Ratsuchende nicht schwerer geworden ist, den Weg zu dieser Beratungsstelle zu finden. Möglicherweise hat das Format zu weniger Scheu vor einer ersten Kontaktaufnahme beigetragen. Es ist für Ratsuchende nicht nötig – im Gegensatz zu Präsenzberatung –, das eigene Äußere und die Stimme zu offenbaren, und auch der Name kann durch eine inoffizielle E-Mail-Adresse anonymisiert werden. E-Mails können zu jeder Zeit versendet werden – eine Bindung an Sprechstunden gibt es nicht. Ein Anliegen kann unmittelbar adressiert werden (auch wenn die Antwort erst später eintrifft). Formulierungen können gut überlegt werden. Vorsichtiges Vortasten über mehrere E-Mails, um ein Gefühl zu bekommen, wie die*der Berater*in auf das Anliegen eingeht, ist möglich, ebenso ein Austausch mit der*dem Berater*in über einen längeren Zeitraum.
Für Berater*innen bringt E-Mail-Beratung ebenfalls Vorteile: Auch sie können sich mehr Zeit nehmen, um passende sensible Formulierungen zu finden und ihre E-Mails gut strukturiert aufzubauen. Sie können sorgfältig hilfreiche Informationen sowie Links recherchieren und in ihre E-Mail integrieren, die Ratsuchende jederzeit abrufen können. Sowohl Berater*innen als auch Ratsuchende haben über den E-Mail-Austausch gleichzeitig eine genaue Dokumentation des Beratungsverlaufs.
Gleichzeitig stellen E-Mail-Beratungen Ratsuchende und Berater*innen vor größere Herausforderungen: Durch den rein schriftlichen Kontakt fällt es schwerer, sich ein Bild vom Gegenüber, seinen Gefühlen und der Situation zu machen. Wie lässt sich beispielsweise mit Unklarheiten und Andeutungen umgehen? Nachfragen sind natürlich weiterhin möglich, aber sie können nur zeitversetzt erfolgen.
Mittlerweile sind Präsenzberatungen wieder möglich. Doch vermutlich werden sich digitale Formate, insbesondere E-Mail, weiter halten oder gar zunehmen. Sie bilden eine zusätzliche Chance, Betroffene zu erreichen und zu unterstützen. Ein Grund, sie offensiv anzubieten und sich intensiv damit zu beschäftigen, wie sie für die Ratsuchenden und Berater*innen gut gestaltet werden können.
Weitere Informationen
Neu eingerichtet wurde Anfang Juni eine spezielle E-Mail-Adresse für Anliegen zu sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt: no-means-no@fu-berlin.de