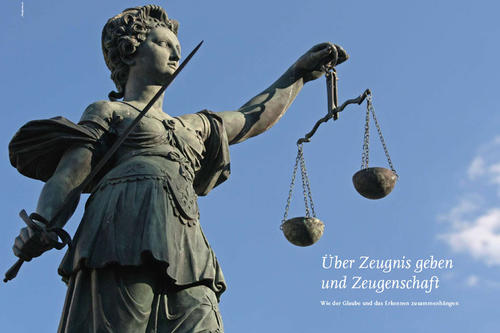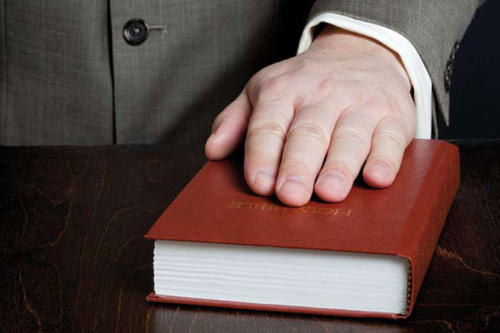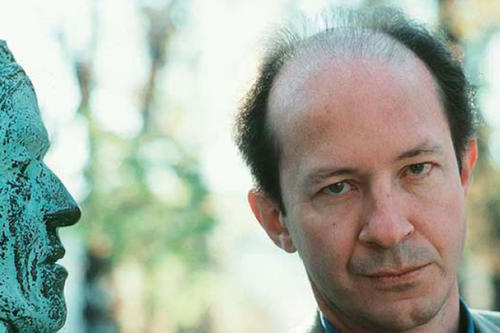Über Zeugnisgeben und Zeugenschaft
Wie der Glaube und das Erkennen zusammenhängen
08.12.2009
Der Wissenschaftsphilosoph Wolfgang Stegmüller stellte fest, dass man schon etwas glauben müsse, um von Wissen und Wissenschaft überhaupt reden zu können.
Bildquelle: iStockphoto.com
Im Rechtsstreit entsteht eine Situation von Ungewissheit, in der paradigmatisch hervortreten kann, wie das Bezeugen und die Entstehung von Wissen zusammenhängen.
Bildquelle: iStockphoto.com
Der Philosophen Giorgio Agamben vermutete im Potenzial der Zeugenschaft auch ein Unvermögen und eine Unfähigkeit des Bezeugens.
Bildquelle: Ullsteinbild
In der Urszene der Wahrheitsfindung sieht Immanuel Kant den „Richterstuhl der Vernunft“.
Bildquelle: Wikimedia
Folgen wir, wenn wir glauben, mehr oder weniger blind unbewiesenen Annahmen? Vertauschen wir, indem wir glauben, ein Nichtwissen mit einem bekenntnisreichen Dafürhalten? Ist der Glaube somit ein Gegenspieler des Wissens? Im Horizont der Auseinandersetzung um Religion und Wissenschaft, der Konkurrenz gar zwischen Religion und Philosophie, könnte es gerade so erscheinen: Der Glaube ist eine Schwundstufe der Vernunft. Die Sachlage so zu sehen, heißt dann allerdings, den „Glauben“ zu einem „Wissensproblem“, zu einem epistemologischen Sachverhalt zu machen.
Unser alltäglicher Sprachgebrauch legt noch eine andere Bedeutung des Wortes „Glauben“ nahe, die wirksam wird in unserem Verhältnis zu „glaubwürdigen“ Menschen: Dies Art von Glauben wurzelt in dem Vertrauen, das wir jemandem schenken, auf den wir uns verlassen und auf den wir „bauen“ können. Glauben wir an eine Person, so sind wir von ihr „überzeugt“. Und wenn wir an uns selbst glauben, zeugt dies zumindest von Selbstvertrauen. Nicht um die Kompensation eines Wissensdefizites geht es dabei, sondern um das Verhältnis zu Mitmenschen, mithin um ein ethisches, ein soziales Phänomen. Ein Gutteil des religiösen Glaubens wurzelt in dieser auf personalem Vertrauen gegründeten Verankerung des Glaubens.
Schon die griechische Sprache kennt einen Unterschied: Während doxa als bloße Meinung den Gegenpol zu begründetem Wissen bildet, markiert pistis einen in Vertrauen und Treue begründeten Glauben an andere. Eine augenfällige Divergenz tut sich also auf zwischen „wahrheitstheoretischem“ und „personalem“ Glauben: Einerseits wird der Glaube – epistemisch gesehen – mit Unwissenheit verbunden; andererseits tritt er – ethisch betrachtet – mit Überzeugung und Sicherheit auf. Wir wollen diese Unterscheidung nicht weiter ausbuchstabieren, sondern umgekehrt einen Verbindungspunkt beider suchen. Gibt es also einen Sachverhalt, in dem sich die epistemologische und die ethisch-personale Dimension berühren?
Erst Glauben, dann Wissen
Der Wissenschaftsphilosoph Wolfgang Stegmüller hat festgestellt, dass man bereits etwas glauben müsse, um von Wissen und Wissenschaft überhaupt reden zu können. Damit wird Glaube und Wissen nicht gegeneinander ausgespielt, vielmehr einander als komplementär gedacht. Wie aber lässt sich eine solche Ergänzung denken? Wir wollen darauf eine Antwort geben anhand eines einzelnen Phänomens: des Zeugnisgebens und der Zeugenschaft. Wenn wir eine Sprache lernen, wenn wir Kenntnis davon haben wann, wo und vom wem wir geboren wurden, wenn wir ein Wissen über vergangene Zeiten und ferne Länder erwerben, die Nachrichten hören, ein Lexikon zu Rate ziehen, die Fahrplanauskunft anrufen oder einen Stadtplan zu Hilfe nehmen: Dann erwerben wir ein Wissen durch Worte und Schriften anderer. Sich auf Informationen zu verlassen, die nicht von uns ermittelt, vielmehr uns nur übermittelt wurden, bildet die Grundlage unserer praktischen wie theoretischen Weltorientierung. Wie viel von dem, was wir für Erfahrungstatsachen halten, haben wir tatsächlich erfahren und nicht etwa nur gehört oder gelesen? Und dies gilt für unseren Alltag ebenso wie für die Wissenschaft. Dass wir unser Wissen durch das Zeugnis anderer erwerben (müssen), ist ein allgegenwärtiges Phänomen: Erziehung und Kultur wären anders gar nicht möglich.
Aber liegt darin nicht ein Problem? Zu wissen heißt, doch zu wissen, „warum sich etwas so und nicht anders verhält“. Und die Rechtfertigung dieses „Warum“ kann doch nur – so jedenfalls sehen es viele Philosophen – entweder der eigenen unmittelbaren Wahrnehmung folgen oder dem schlussfolgernden Denken und natürlich noch durch die Erinnerung an eine solche Wahrnehmung oder Schlussfolgerung. Wenn dies aber die einzigen Quellen unseres Wissens sind, wieso können wir dann überhaupt etwas „wissen“, wenn fast alles, was wir wissen, übernommen ist von anderen? Wieso kann das Zeugnisgeben überhaupt etwas erschaffen, was das Prädikat „ein Wissen zu sein“ auch verdient?
Rechtsstreit als Ungewissheit
Es lohnt, auf die Figur des Gerichtszeugen zurückzugehen, ist im Rechtsstreit doch eine Situation von Ungewissheit gegeben, in der paradigmatisch hervortreten kann, wie das Bezeugen und die Entstehung von Wissen zusammenhängen. Der Zeuge hat vor dem Gericht auszusagen, über ein vergangenes Ereignis, das er zwar wahrgenommen hat, in dessen Unkenntnis aber die Jury oder der Richter ist. Das Zeugnisgeben hat also Evidenz zu erschaffen für etwas, wozu zwar der Zeuge, nicht aber sein Auditorium unmittelbaren Zugang hat. Und dieser Akt der Evidenzschaffung ist von weitreichender Folge: Es gilt nicht einfach, eine Wahrheit zu ermitteln, sondern zur Feststellung von Schuld oder Unschuld beizutragen. Es waren übrigens die Zeugen, die im antiken jüdischen Gerichtsverfahren den ersten Stein bei der Hinrichtung des Verurteilten zu werfen hatten.
Der Zeuge muss also seine persönliche Wahrnehmung in eine öffentlich zu verstehende Sprache transponieren. Doch hier ergibt sich ein Problem: Mentale Zustände wie Wahrnehmungen, Erlebnisse und Erfahrungen sind nicht übertragbar. Wie der Kommunikationstheoretiker John Durham Peters lakonisch feststellt: „No transfusion of consciousness is possible. Words can be exchanged, experiences can not.“ Und noch etwas kommt hinzu: Was immer wir sprachlich vermitteln, kann auch gelogen sein, ist es doch die Eigenart der Sprache, die Möglichkeit der Lüge zu eröffnen. Eben dies unterscheidet die Zeugenaussage von gewöhnlichen Spuren oder indexikalischen Zeichen, die als Beweismittel dienen und die zwar falsch gelesen und interpretiert werden können, nicht aber „lügen“. Überdies haben empirische Untersuchungen gezeigt, wie irrtumsanfällig das Bezeugen ist: Verschiedene Personen – bei demselben Ereignis anwesend – präsentieren ebenso viele Geschichten des Geschehens. Unser Gehirn füllt die faktischen Lücken unserer Informationsaufnahme und unseres Gedächtnisses großzügig auf, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst werden – und das alles in einer Situation, in der Zeugenaussagen in epistemischer Hinsicht kaum überprüfbar sind.
Bezeugen kann fehlerhaft sein
Wir sehen also: Das Bezeugen, ein in sozialer Hinsicht äußerst folgenreicher Vorgang, ist gezeichnet von hoher Fehlbarkeit. Wir können das mit dem Philosophen Giorgio Agamben auch so sagen: Im Potenzial zur Zeugenschaft nistet ein Unvermögen und eine Impotenz des Bezeugens. So wundert es nicht, dass Aussagen von Gerichtszeugen – selbst wenn sie nicht unter Eid erfolgen – streng ritualisiert und institutionalisiert sind. Der Zeuge redet und berichtet also nicht einfach, sondern äußert durch den Umstand, dass er etwas im „Zeugenstand“ sagt, im institutionentheoretischen Sinne einen Sprechakt. Damit sind Äußerungen gemeint, die das, was sie sagen, zugleich auch vollziehen. Für das Bezeugen heißt dies: Allein dadurch, dass eine Person in der juridischen Funktion des Zeugen aussagt, gilt das, was sie äußert, als eine wahre Aussage. Dies ist der Grund, warum Meineid und Falschaussagen unter so hoher Strafe stehen. Und doch: Selbst diese institutionentheoretischen Absicherungen der evidenzschaffenden Kraft der Zeugenaussage können die empirische Unüberprüfbarkeit und psychologische Irrtumsanfälligkeit und damit verbunden eine prinzipielle Fallibilität der Zeugenaussage nicht außer Kraft setzen. Was auch immer der Zeuge sagt: Es kann – im Prinzip – ein falsches Zeugnis sein.
An dieser Stelle nun stoßen wir auf die fundamentale Bedeutung des „Glaubens“ im Sinne eines „Glaubens an jemanden“, der zugleich für „Wissenspraktiken“ relevant wird: Denn für seine Worte kann der Zeuge nur einstehen mit der Glaubwürdigkeit, der Wahrhaftigkeit und der Vertrauenswürdigkeit seiner Person. Nur der Zeuge überzeugt, dem vertraut wird. Vertrauen allerdings kann stets enttäuscht werden – anderenfalls wäre es kein Vertrauen; das ist der Grund, warum „Vertrauen“ und „Glauben“ ineinander greifen.
Welcher Zeuge ist glaubwürdig?
Daher bleibt die Überprüfung der Glaubwürdigkeit des Zeugen ein wichtiges Element in der Arbeit des Gerichts. Halten wir fest: Die Ungewissheit einer Jury oder eines Richters wird sich nur dann in die Form einer Gewissheit verwandeln lassen, wenn dem Zeugen eine zu erwartende Übereinstimmung in Denken und Handeln bescheinigt und also Vertrauen entgegen gebracht wird. Ist dies der Fall, dann ist mithilfe des sozialen Bandes der Vertrauens- und Glaubwürdigkeit tatsächlich eine Übertragung von Wissen durch Zeugen möglich geworden, bei der seitens der Nichtwissenden neues Wissen entsteht. Aus der Perspektive des Auditoriums gesehen: Der Glaube an die Integrität des Zeugen macht aus der Zeugenaussage erst ein Beweismittel und kann so auch neues Wissen beim Auditorium erzeugen. Glauben und Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit werden zur Bedingung der Möglichkeit, Wissen durch Zeugnisgeben zu übermitteln.
Nun haben wir uns hier auf die Gerichtsszene, auf das formale Bezeugen bezogen. Gleichwohl fällt von hier her ein erhellendes Licht auch auf die informelle, die lebensweltliche Bedeutung, die in unserem Angewiesensein auf ein Wissen durch Worte und Schriften anderer liegt. Wenn wir die Idee, man könne Wissen erwerben, alleine durch eigene Wahrnehmung und durch eigenständiges logisches Denken, als „methodologischen Individualismus“ bezeichnen wollen, so zeigt sich nun die Unhaltbarkeit dieser erkenntnistheoretischen Position. Wissenserwerb ist ein sozialer Prozess. Einer der Gründe für diese grundständige Sozialität unseres Wissens im Alltag wie in der Wissenschaft ist der Umstand, dass wir für einen Gutteil unseres Wissen angewiesen bleiben auf jene Situation sozialer Interaktion, in der wir durch andere informiert und instruiert werden – ohne die Möglichkeit der eigenhändige Überprüfung; und daher dem, was wir hören oder lesen, somit glauben und vertrauen müssen, sobald wir es in unsere Überzeugungen eingliedern wollen. Und dieses Überzeugt-Sein wird umso nachhaltiger, je mehr wir ausgehen können von der Integrität der instruierenden Personen und der Autorität und Reputation der informierenden Institution. Wir sehen also: Das soziale Band des Vertrauens wird durch die Netze unseres Wissens erst geknüpft. Nicht zufällig bildet für viele Philosophen das Gerichtswesen die Urszene der Wahrheitsfindung – so etwa, wenn Immanuel Kant vom „Richterstuhl der Vernunft“ spricht, oder wenn wir Aussagesätze mit Wahrheitsanspruch als „Urteile“ bezeichnen. Denn ähnlich, wie die juridische Wahrheitsermittlung Wissen und Verantwortung, Erkenntnis und Ethik miteinander verbindet, so gründet der Wissenserwerb auch im alltäglichen und wissenschaftlichen Rahmen auf einer grundlegenden Verbindung zwischen dem Wissen von Sachverhalten und dem Vertrauen in Personen.
Wissen und Glauben greifen nicht nahtlos ineinander
Gleichwohl greifen Wissen und Glauben nicht so nahtlos ineinander, wie es das hier gezeichnete Bild nahelegt. Denn tatsächlich nisten in der Figur des Zeugens Dilemmata, die schon beim Gerichtszeugen zutage treten. Denn der Zeuge fungiert in einer merkwürdigen Doppelrolle: Einerseits soll er wie der teilnahmslose Seismograph eines Geschehens, wie ein „Datenerhebungsinstrument“ – unabhängig aller eigenen Meinungsbildung, Beurteilung und Kommentierung – ein Ereignis „aufzeichnen“ und „wiedergeben“; er ist also ein umso besserer Zeuge, je weitergehend er von persönlichen Interessen, Meinungen und Präferenzen abzusehen, sich also zu depersonalisieren vermag. Zugleich jedoch muss er sich als eine zuverlässige und kohärente Person erweisen, bei der äußeres Verhalten und innere Überzeugungen übereinstimmen, um überhaupt vertrauens- und glaubwürdig zu sein. Zugespitzt ausgedrückt: Der Zeuge hat sich zugleich wie ein „neutrales Ding“ und wie eine „authentische Person“ zu verhalten. Dieses Dilemma der Zeugenschaft tritt in zwei seiner Extremversionen besonders zutage, dem Blutzeugen (Märtyrer) und dem Überlebenszeugen.
Denken wir an den Märtyrer: Das griechische martys heißt „Zeuge“ und martyrein „bezeugen“. Erst sukzessive haben in der christeologischen Perspektive diese Worte den heute gebräuchlichen Sinn des „Märtyrers“ als Blutzeugen angenommen. Die Apostel der christlichen Tradition erhoben noch einen Anspruch auf Augenzeugenschaft, da ihnen der „wiederauferstandene Jesus“ persönlich begegnet sei. Doch für die „gewöhnlichen“ Christen gilt eben dies nicht. Christen können somit nicht mehr von der Immanenz einer Wahrnehmung Christi, sondern nur noch von der Transzendenz ihrer Glaubenserfahrung zeugen. Die Glaubwürdigkeit einer Person wird jedoch da am stärksten, wo sie zur Selbstaufgabe im Sterben bereit ist. So ist ein Weg eingeleitet, auf dem die Bürgschaft für die Wahrheit nicht mehr in den Worten, sondern im leidenden Körper und im Tod liegt. Sören Kierkegaard hat daher die existenziale Wahrheit des Christseins als eine unübertragbare Wahrheit gekennzeichnet – eine Wahrheit, die wir nicht wissen, sondern nur sein und leben können, und er hat daher eine märtyrerhafte Dimension in jedem religiösen Leben vermutet.
Überlebenszeugen sind in einem Dilemma
Oder denken wir an den Überlebenszeugen: Die Toten einer Katastrophe können nicht mehr von diesem Ereignis zeugen. So sind Überlebenszeugen in einer dilemmatischen Situation: Der Überlebende markiert die durch die Toten hinterlassene Leerstelle des Zeugens, verkörpert also ein Stück weit die Unmöglichkeit des Bezeugens eines vernichtenden Ereignisses gerade mit seinem Leben, das eben dieser Vernichtung entkam. Überdies zerstört das Durchlebte beim Opfer nicht selten jene Kohärenz und Integrität der Person, die wiederum Voraussetzung dafür ist, dass das Bezeugen als Instanz einer „Wissensvermittlung“ überhaupt zu fungieren vermag. Giorgio Agamben hat das am Beispiel der tragischen Figur des „lebendigen Leichnams“ des „Muselmanns“ in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten gezeigt: Indem diese sich selbst aufgeben und von den Mithäftlingen aufgegeben werden, schwindet mit ihrem Verlust von Wille, Überlebenswille, Identität und Personsein die personale Basis, etwas noch bezeugen zu können; gezeichnet von dieser Aporie werden sie dann für Agamben zu „absoluten Zeugen“ für die Paradoxie der Holocaust- Zeugenschaft.
Zeugenschaft entzieht sich der Empirie
Diese Sonderformen der Zeugenschaft verdienten gründlichere Aufmerksamkeit, als wir dies hier leisten können. Wir wollen mit der Figur des Märtyrers und des Überlebenszeugen lediglich aufmerksam machen auf mögliche Dilemmata, die eine Situation birgt, in der das Verhältnis von „Glauben“ und „Wissen“ sich zu solchen „Radikalformen“ des Bezeugens verdichtet. Lösen wir uns jetzt von diesen dramatischen Formen der Zeugenschaft und kommen zurück auf den alltäglichen Umstand, unser Wissen zum Gutteil durch die Worte und Schriften anderer zu beziehen. Unser Nachdenken über das Zeugnisgeben hat gezeigt, dass angesichts der empirischen Unüberprüfbarkeit der Zeugenaussage nicht einfach dieser Aussage, vielmehr der Person desjenigen, der etwas bezeugt, zu glauben ist. Damit aber erweisen sich Glauben und Vertrauen – verstanden als interpersonale Beziehung – als Fundament unserer Fähigkeit zum Wissenserwerb. Wir müssen von einer konstitutiven Sozialität unseres Wissens ausgehen. Die Reflexion des Zeugnisgebens kann so zur Grundlage einer „sozialen Epistemologie“ werden; Erkennen und Anerkennen durchdringen einander. Die zweifache Semantik im Begriff des „Glaubens“, sowohl ein erkenntnistheoretisches Defizit auszusagen wie auch eine ethische Bindung existenzialen Vertrauens aufzurufen, findet ihr Echo in der Verbindung von Erkenntnis und Ethik. „Vertrauen“ und „Glauben“ in die Worte anderer bildet einen Kern unserer Episteme.
Weitere Informationen
Prof. Dr. Sybille Krämer:
Sybille Krämer ist Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin und Sprecherin des Graduiertenkollegs 1458 „Schriftbildlichkeit. Über Materialität, Wahrnehmbarkeit und Operativität von Notationen“. Sie ist zudem Projektleiterin im Sonderforschungsbereich ‚Kulturen des Performativen’ und im Exzellenzcluster ‚Topoi‘. Von 2000 bis 2006 war sie Mitglied im Wissenschaftsrat, von 2005 bis 2008 Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, und sie ist Gutachterin des European Research Council, Brüssel. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Theorie des Geistes und des Bewusstseins; Philosophie der Sprache, der Schrift und des Bildes; Theorie und Philosopfhie der Medien. Zuletzt erschienene Monographien: Sprache, Sprechakt, Kommunikation. Sprachtheoretische Positionen des 20. Jahrhunderts (Frankfurt 3. Auflage 2006); Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität (Frankfurt 2008).